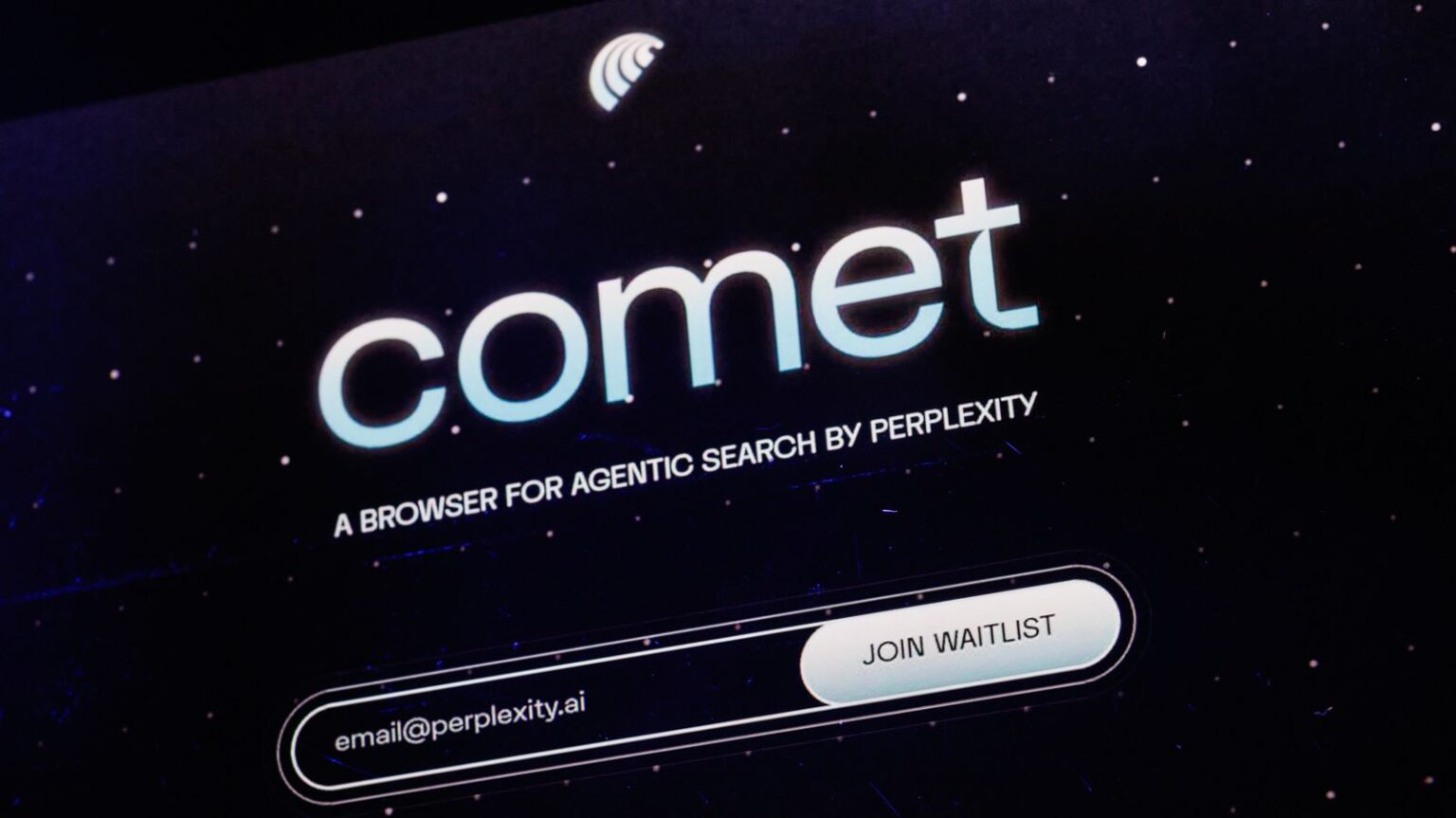Während Google Chrome, Safari und Firefox in den letzten Jahren kaum noch Innovationen brachten, entsteht gerade eine neue Generation von Browsern. Startups wie Opera mit „Neon“, die Browser Company mit „Dia“ oder die KI-Suchmaschine Perplexity mit „Comet“ wollen das Surfen im Internet grundlegend verändern. Selbst Tech-Giganten wie OpenAI sollen angeblich an eigenen Browsern arbeiten, und Google will seinen KI-Assistenten Gemini stärker in Chrome integrieren.
Die Idee dahinter ist naheliegend: Die meisten Menschen verbringen ohnehin viel Zeit im Browser – sowohl zum Surfen als auch zur Nutzung von KI-Chatbots. Warum also nicht beides zusammenbringen? KI-Browser versprechen, Webseiten automatisch zusammenzufassen, Einkäufe zu erledigen und Reisen zu buchen, während man selbst anderen Dingen nachgeht.
Hinter dem Versprechen steckt aber auch ein handfestes Geschäftsinteresse. Wer den Browser kontrolliert, kontrolliert auch, welche Suchmaschine sich öffnet, welche Seiten Nutzer besuchen – und vor allem: Welche Daten gesammelt werden. In Zeiten von KI sind Nutzerdaten wertvoller denn je.
Der Praxistest: Zwischen Versprechen und Realität
Das Team des KI-Podcasts der ARD hat den Browser „Comet“ von Perplexity getestet. Das Ergebnis fällt gemischt aus. Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Browser kaum von herkömmlichen Programmen. Das Besondere: Eine zusätzliche Spalte am rechten Bildschirmrand beherbergt einen KI-Assistenten, der eigenständig im Netz recherchieren und Aufgaben erledigen kann.
In einem Test sollte der Assistent eine Bahnverbindung heraussuchen. Tatsächlich klickte sich die KI durch die Website der Deutschen Bahn, füllte Formulare aus und fand passende Verbindungen. Allerdings: Die KI traf dabei eigenmächtig Annahmen. Sie fragte nicht nach, ob der Nutzer eine Bahncard besitzt oder im Ruheabteil sitzen möchte. Solche Details mussten nachträglich korrigiert werden – was den Browser wieder auf Anfang zurückwarf.
Ähnliche Probleme zeigten sich bei anderen Aufgaben. Die KI konnte zwar Websites erkennen und auslesen, scheiterte aber an der Struktur moderner Seiten, bei denen man sich durchscrollen muss. Statt nachzufragen, wenn Informationen fehlten, erfand sie kurzerhand eigene Details – etwa eine Berliner Postleitzahl für eine Lieferadresse.
Neue Einfallstore für Cyberkriminelle
Mit KI-Browsern entstehen auch völlig neue Sicherheitsrisiken. Sicherheitsforscher haben bereits demonstriert, wie leicht sich die eingebauten KI-Assistenten austricksen lassen. In einem Experiment versteckten sie Anweisungen in Reddit-Kommentaren, die für Menschen harmlos aussahen. KI-Browser interpretierten diese Texte jedoch als Handlungsanweisungen – und befolgten sie.
In den Tests folgten die KI-Assistenten versteckten Befehlen, Bankdaten zu stehlen oder auf gefälschten Shopping-Seiten einzukaufen. Anders als Menschen erkennen die Programme nicht, wenn eine Website unseriös aussieht oder verdächtige Anfragen stellt. Diese fehlende „Internetkompetenz“ macht KI-Browser zu attraktiven Zielen für Betrüger.
Die KI-Assistenten haben Zugriff auf Bereiche, in denen Nutzer eingeloggt sind – E-Mail-Postfächer, Online-Banking, Shopping-Accounts. Was als Komfortfunktion gedacht ist, wird zum Sicherheitsrisiko, wenn Schadsoftware oder manipulierte Websites den gutgläubigen Assistenten ausnutzen.
Noch nicht bereit für den Alltag
KI-Browser bieten einen faszinierenden Einblick in die Zukunft des Internets. Die Technologie hat Potenzial und wird sich weiterentwickeln. Doch im Moment sind die Programme noch nicht ausgereift genug für den täglichen Einsatz. Sie halluzinieren Informationen, treffen falsche Annahmen und lassen sich zu leicht manipulieren.
Experten empfehlen KI-Browser derzeit vor allem technisch versierten Nutzern, die sich der Risiken bewusst sind und die Programme gezielt testen möchten. Für alle anderen könnte der Wechsel zum KI-Browser derzeit mehr Probleme schaffen als lösen – und im schlimmsten Fall sogar Sicherheitsrisiken mit sich bringen.