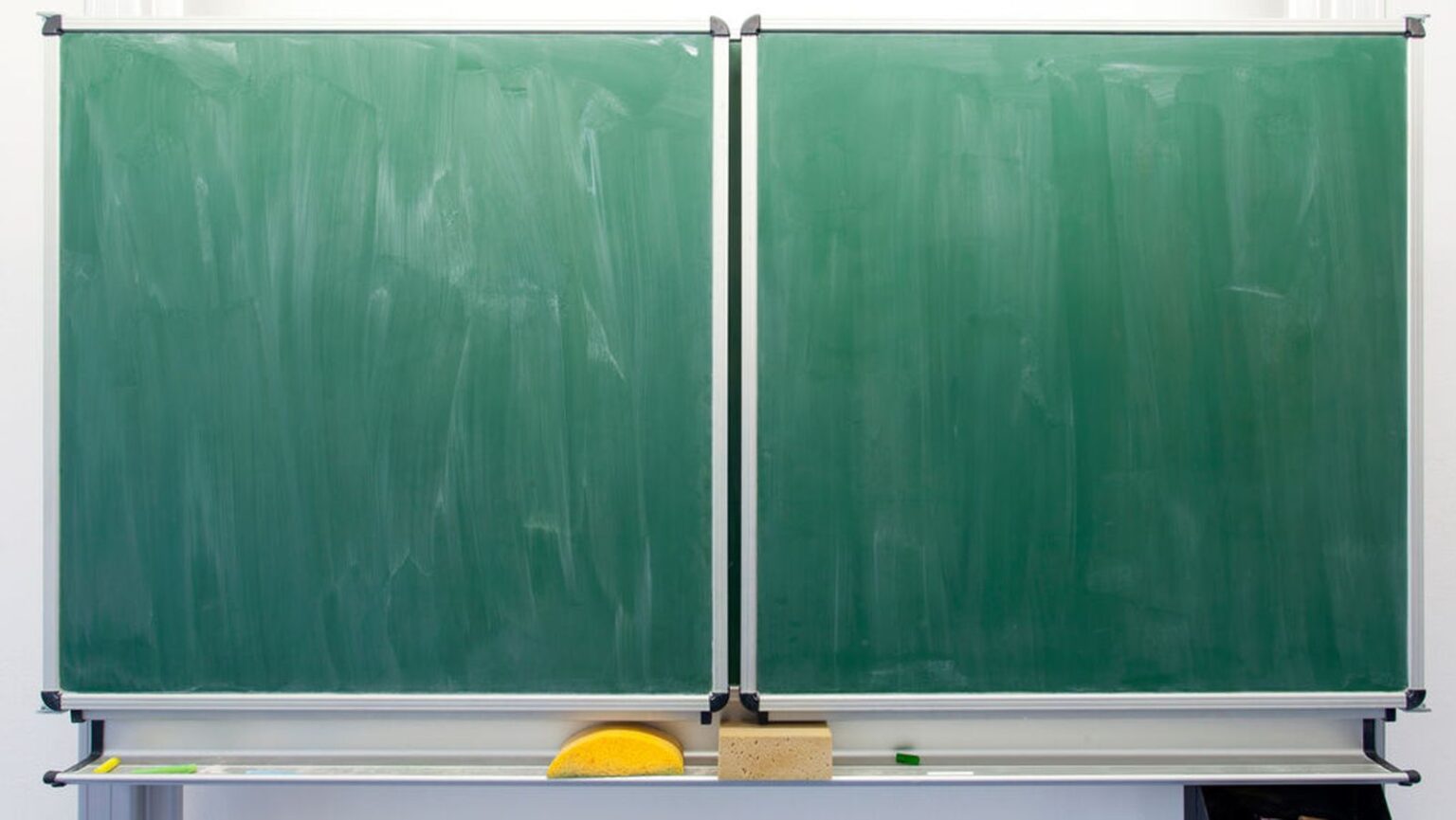Ein Montag im November, 13.30 Uhr. Die 8. Klasse des Gymnasium Herrsching kommt gerade aus der Mittagspause zurück ins Klassenzimmer. Jetzt steht eine Doppelstunde Geschichte an, bei Herrn Kraft. Es ist die letzte Stunde vor einer angekündigten Kurzarbeit zum Thema Französische Revolution.
Thomas Kraft unterrichtet seit 6 Jahren Deutsch und Geschichte. Aber: Er ist kein studierter Lehrer. Eigentlich ist er Autor und hat, nach seinem Studium in neuerer deutscher Literatur, Theaterwissenschaften und Philosophie, lange in der Literaturbranche gearbeitet. In den unterschiedlichsten Bereichen: Mehrere Jahre war er Programmleiter des Münchner Literaturhauses, Buchhändler und Veranstalter von Literaturfestivals. „Und dann kam Corona und das, was bisher eigentlich sehr, sehr gut lief, war auf einen Schlag beendet.“
In Bayern fehlen Lehrkräfte
Das war der Moment, in dem Thomas Kraft sich an einen alten Berufswunsch erinnerte. „Traum ist zu hoch gegriffen, aber es war tatsächlich so, dass ich direkt nach dem Abitur mir überlegt habe, Lehramt zu studieren. Nur war damals die Situation Ende der 70er-Jahre so, dass man keine Lehrer brauchte.“
Das ist heute anders: Die fehlenden Lehrstellen in Bayern gehen in die Tausende. Laut Prognosen des Bayerischen Kultusministeriums wird der Bedarf an Lehrkräften im kommenden Jahr an Realschulen nur zu knapp über 80 Prozent und an Mittelschulen zu nicht einmal 50 Prozent gedeckt sein können. Deswegen wirbt das Kultusministerium offensiv um Quereinsteiger – aus welchen Branchen sie kommen, wird nicht erhoben.
Normalerweise müssen Quereinsteiger das Referendariat nachholen. Thomas Kraft war eine Ausnahme, aufgrund seiner Promotion und Lehrerfahrung an der Uni konnte er direkt starten. Er ist bis heute glücklich mit der Entscheidung und arbeitet Vollzeit als angestellter Lehrer. Aber so geht es nicht allen.
Oft fehlt die pädagogische Ausbildung
„Was man erfährt, wenn man jetzt an die Schule geht – ich zumindest – ist das politische Systemversagen“, sagt Insa Wilke. Sie ist preisgekrönte Literaturkritikerin und -vermittlerin, sie konzipierte Literaturveranstaltungen, saß in der Jury des renommierten Bachmann-Preises und publiziert auch selbst. Jetzt unterrichtet sie Deutsch und Geschichte an einer Gemeinschaftsschule in Berlin, während sie parallel ihr Referendariat nachholt. An die Schule wollte sie vor allem aus einem Gefühl der politischen Ohnmacht heraus. „Im Moment läuft gesellschaftlich und politisch und auch kulturpolitisch so viel schief, dass ich den Drang hatte, irgendwo ganz konkret arbeiten zu können.“
An der Schule begegnet sie extrem engagierten Lehrkräften, denen es jedoch durch eine unflexible Bildungspolitik schwer gemacht wird, ihre Arbeit gut zu machen. Viele Klassen sind zu groß, der Arbeitstag manchmal 17 Stunden lang. „Es gäbe die Möglichkeit, die junge Generation, die wir in der Gesellschaft brauchen, so auszubilden, dass sie dann auch tatsächlich in der Gesellschaft von Nutzen sind. Das wird im Moment brach liegen gelassen und ich habe den Eindruck, es gibt keinen politischen Willen, diese Situation zu verändern.“
Um wirklich etwas zu verändern und eigene Erfahrungen an Kinder und Jugendliche sinnvoll weiterzugeben – dafür braucht es pädagogische Kompetenz. Die bringen Quereinsteiger aus dem Literaturbetrieb nicht zwangsläufig mit, sagt Wilke. „Als Lehrerin musste ich tatsächlich alles, alles, alles neu lernen und es stellt sich für mich auch die Frage, wie sinnvoll das ist, mit fast 50 tatsächlich noch mal an den Nullpunkt zu gehen, wenn man die Hälfte des Lebens rum hat, ob man die Kräfte nicht in Dinge stecken sollte, die man schon kann und wo man auch gebraucht wird.“
Aus der Literaturbranche in die Lehre – das ist also nicht per se für jeden der richtige Weg.