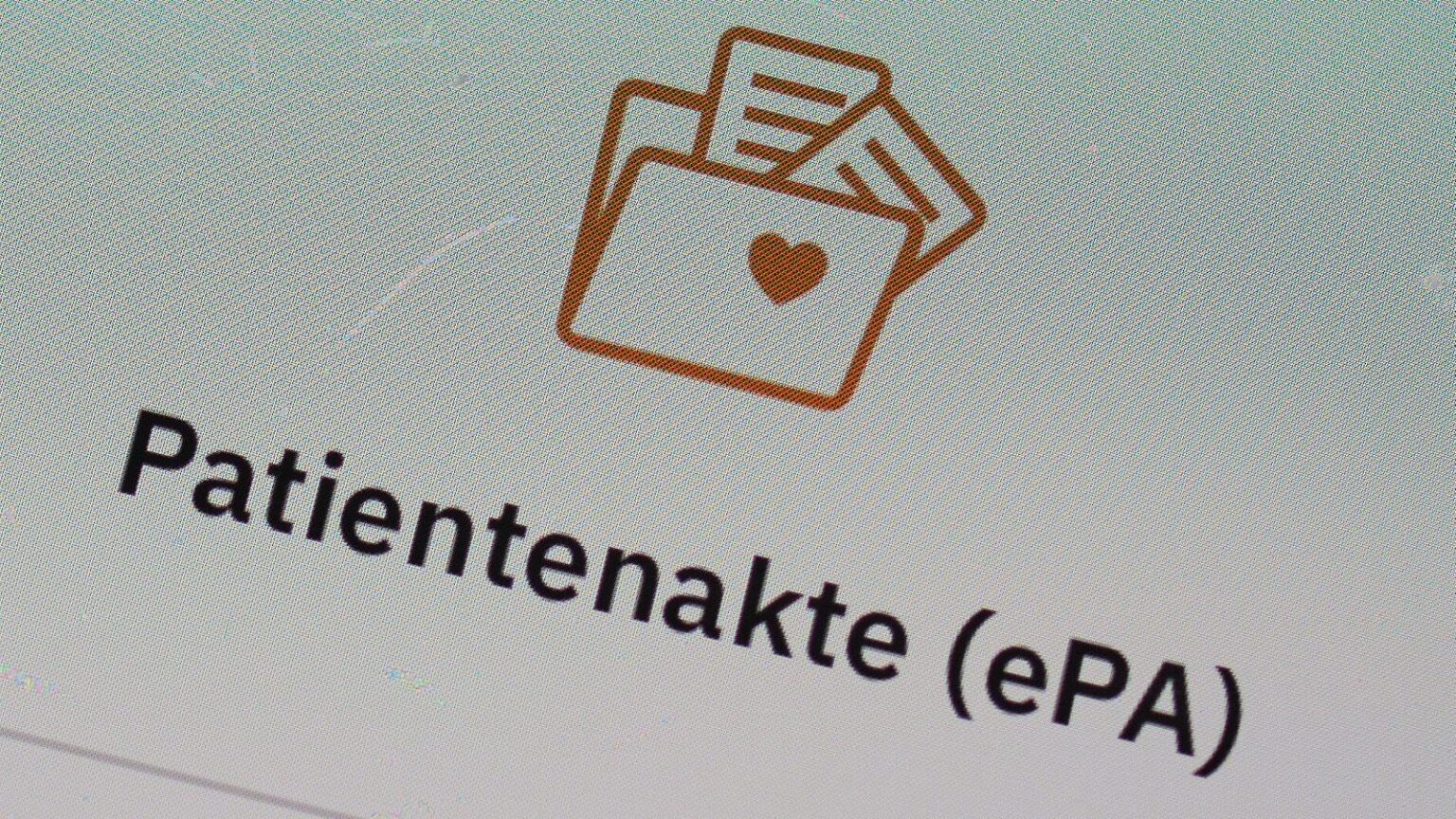Die elektronische Patientenakte (ePA) soll die medizinische Versorgung digital und transparent machen. Seit Jahresbeginn steht sie allen gesetzlich Versicherten zur Verfügung: Wer nicht möchte, muss aktiv widersprechen. Doch auch nach fast sieben Monaten wird die ePA von Patientinnen und Patienten kaum angenommen. Bei den großen Krankenkassen liegt die Anzahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Als Gründe werden häufig technische Probleme, eine komplizierte Anmeldung und fehlende Nutzerfreundlichkeit genannt.
Hausärztinnen und Hausärzten schlagen Alarm
Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, Markus Beier, sieht das Projekt daher auf dem Weg zu einer „Bruchlandung“. Die ePA sei zu kompliziert und „nicht alltagstauglich“. Zudem hätten viele Patientinnen und Patienten bislang kaum etwas von ihrer Akte mitbekommen, kritisierte Beier gegenüber der „Rheinischen Post“ und knöpfte sich in diesem Zusammenhang vor allem die Krankenkassen vor. Diese hätten „bei der Aufklärung ihrer Versicherten die Hände in den Schoß gelegt“. Damit bleibe vielen der praktische Nutzen der ePA verborgen. Der Bayerischen Hausärztinnen- und Hausärzteverband sieht die Sache ähnlich. Die Krankenkassen hätten sich darauf beschränkt, „vereinzelt Briefe mit allgemeinen Informationen zu versenden“. Notwendig wäre vielmehr „eine große und koordinierte Informationskampagne gewesen“, kritisierte der Verband gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.
Lob und Tadel von Verbraucherschützern
Die Rückmeldungen von Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützern zur ePA zeichnen ein zwiespältiges Bild. Technische Instabilitäten, fehlende Volltextsuchen und unklare Zugriffsrechte führen laut Verbraucherzentrale Bundesverband häufig zu Frust. Es mangele es an Praxis- und Patientenorientierung, Datenschutzlücken und unvollständige Akten gefährden das Vertrauen. Trotz Nachbesserungen gebe es nach wie vor Schwachstellen in der IT-Sicherheit sowie Unklarheiten über den Opt-out-Mechanismus – also den Zwang zum aktiven Widerspruch – der dazu führe, dass viele Versicherte eine ePA erhielten, ohne es zu wissen oder zu wollen.
Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern führt dies nicht zuletzt auf die Informationspolitik der Krankenkassen zurück. Grundsätzlich seien die Kassen zwar „den gesetzlichen Vorgaben gefolgt, aber eben nicht verständlich genug“, bemängelte Straub im BR-Interview. Dadurch sei es zu viel „Fehlinformation und Missinterpretation“ gekommen. Eine Umfrage unter Patientinnen und Patienten habe ergeben, dass es vor allem an zwei Stellen hapere. Der Zugang zur ePA ausschließlich über die App der Krankenkasse sei noch nicht divers genug und die unzureichenden Informationen über den Datenschutz hätten zu teilweise „unberechtigten Vorbehalten“ geführt. Denn bei aller Kritik stellt Straub klar: „Die ePA ist an sich ein sicheres Produkt.“
Krankenkassen: „Haben uns an die Vorgaben gehalten“
Der Spitzenverband der Krankenkassen beharrt darauf, dass über 70 Millionen elektronische Patientenakten termingerecht angelegt und die Versicherten rechtzeitig informiert worden seien. Der bevorstehende Pflichtstart für Ärzte im kommenden Oktober werde die Nutzung deutlich steigern. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) gibt sich ebenfalls zuversichtlich. Die ePA sei ein wichtiger Fortschritt für eine bessere Versorgung, weniger Doppeluntersuchungen und mehr Transparenz. Zugleich mahnt die DKG für die kommenden Monate zu einer breiten, positiven Kommunikation, um die ePA nicht scheitern zu lassen.
Nachbesserungen für mehr Akzeptanz
Damit dies nicht passiert, fordern Patientenvertreter und Verbraucherschutzorganisationen schnellere Verbesserungen bei der Nutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und Information. Die ePA sei zwar gesetzlicher Standard, doch im Praxisalltag noch nicht angekommen. Entscheidend werde sein, wie schnell Krankenkassen, Ärztinnen, Kliniken und Politik die vielfältigen technischen und kommunikativen Probleme beheben.
Ohne verständliche Informationsangebote, einfache Apps und stabile Systeme droht das Vorhaben eines der größten Digitalprojekte des Gesundheitswesens ausgerechnet an der mangelnden Akzeptanz zu scheitern.