Arnold Schönberg zum 150. Geburtstag
Was über Schönberg zu wissen lohnt
Was über Schönberg zu wissen lohnt
Für viele ist seine Musik bis heute ein rotes Tuch. Dabei wünschte sich Arnold Schönberg nichts sehnlicher, als dass man ihn „für eine bessere Art von Tschaikowsky hält“. Mit seiner Zwölftontechnik hat er die Musik des 20. Jahrhunderts geprägt wie kein Zweiter. Daneben war Schönberg aber auch ein charismatischer Lehrer, kurioser Erfinder, leidenschaftlicher Tennisspieler – und schrecklich abergläubisch. Seine Vorhersage, man werde seine Melodien eines Tages auf der Straße pfeifen, hat sich zwar nicht erfüllt. Aber seine Musik ist trotzdem der ideale Begleiter für die berühmte einsame Insel.

Bildquelle: picture-alliance/Imagno
Resilienz – vielleicht war das sein herausragender Charakterzug. Arnold Schönberg war unkaputtbar. Schon als Kind lernte er, seine Begabung gegen widrige Bedingungen zu behaupten. Seine Eltern waren kleine Leute, betrieben in Wien ein Schuhgeschäft – und standen dem musikalischen Talent ihres am 13. September 1874 geborenen Sohns ziemlich ratlos gegenüber. Und so musste sich der kleine Arnold seine musikalischen Kenntnisse eben selbst beibringen – mit Hilfe von Meyers Konversationslexikon, das die Eltern auf Raten abonniert hatten. Sehnsüchtig erwartete er den Band mit dem Buchstaben S, um endlich zu erfahren, wie man einen Sonatensatz komponiert. Theorieunterricht? Fehlanzeige! Schönberg blieb Autodidakt – und er war stolz darauf.
Ich habe vielleicht nur ein Verdienst: Ich gab niemals auf.
Arnold Schönberg
Allein gegen den Rest der Welt
Sein ganzes Leben lang hat er gegen solche Widerstände angekämpft, mit Zähigkeit, Hartnäckigkeit, Willensstärke. Unglaublich, was dieser Mensch alles ausgehalten hat, ohne zu zerbrechen. Ob seine Musik auf Ablehnung stieß und für Skandale sorgte (bis hin zum berüchtigten „Watschenkonzert“ von 1913, in dem es Ohrfeigen hagelte); ob er mit Armut und finanzieller Not kämpfen musste (sogar noch im hohen Alter); ob Ablehnung, Affären, Lieblosigkeit sein Privatleben erschütterten; ob schließlich der Antisemitismus und der Nationalsozialismus seine ganze Existenz bedrohten – immer hielt Schönberg doch, mit schier unerschütterlichem Sendungsbewusstsein, an seiner musikalischen Vision fest. „Ich habe vielleicht nur ein Verdienst: Ich gab niemals auf“, schrieb er im Rückblick. Sein Lebensgefühl: „Ich stand fast allein gegen eine Welt voller Feinde.“
Schönberg und Strauss

Arnold Schönberg beim Dirigieren. | Bildquelle: picture-alliance/dpa
Nun, ganz so schlimm war es glücklicherweise dann doch nicht. Schönberg hatte auch Förderer. Der wichtigste war zu Beginn seiner Laufbahn Richard Strauss. Der erkannte hellsichtig die außergewöhnliche Begabung dieses linkischen jungen Wieners, der seine Banklehre an den Nagel gehängt hatte und nach Berlin gezogen war, um dort – ja, tatsächlich – Kabarett-Kapellmeister zu werden. Strauss rettete Schönberg nicht nur mit Hilfe von Stipendien aus seinen finanziell prekären Verhältnissen, sondern regte ihn auch zu seinem ersten großen Orchesterwerk „Pelleas und Melisande“ an. Lange hielt die Männerfreundschaft allerdings nicht (so wie sich Schönberg auch später immer wieder mit diversen Wegbegleitern zerstritt). „Dem armen Schönberg kann heute nur der Irrenarzt helfen“, lästerte Strauss 1913, und Schönberg revanchierte sich mit den Worten: „Was ich seinerzeit von Strauss gelernt hatte, habe ich, Gottseidank, missverstanden.“
Schönbergs Weg zur Atonalen Musik
Das Zerwürfnis hing auch damit zusammen, dass sich Schönbergs Musik in der Zwischenzeit grundlegend gewandelt hatte. Seine ersten Werke (darunter die monumentalen „Gurrelieder“ und das Streichsextett „Verklärte Nacht“, sein bis heute meistaufgeführtes Stück) standen noch ganz im Zeichen der Spätromantik, in der Nachfolge von Brahms, Liszt und Wagner. Dann aber, etwa ab 1906, drang Schönberg immer weiter zu den Grenzen der Dur-Moll-Tonalität vor, dehnte diese aus, überschritt sie schließlich – wie ein Wanderer, der seinen Führer wegwirft, seine Karte zerreißt, die Pfade verlässt, auf denen schon andere gegangen sind, und ohne Markierung, ohne jede Absicherung hinausschreitet, ungewiss, was ihn hinter dem weiten Horizont erwartet.
Das Beste, was Schönberg je komponiert hat
Drei Stationen auf diesem Weg ins Ungewisse gehören zum Besten, was Schönberg je komponiert hat: Da ist zum einen die Kammersinfonie op. 9 als furioser Aufbruch, ungestüm, ausdrucksstark und zugleich glasklar gegliedert, vielleicht das letzte Schönberg-Stück, das man noch mitsummen kann, obwohl die Übereinanderschichtung von Quarten die Tonalität schon fast zum Bersten bringt. Da ist zum anderen das Zweite Streichquartett, in dem eine Sängerin verkündet: „Ich fühle Luft von anderem Planeten“, während sich die Musik tatsächlich in ungeahnte harmonische Sphären erhebt und dünn wird wie die Luft auf dem Mars. Und da sind schließlich die Fünf Orchesterstücke op. 16, mit denen Schönberg endgültig in der Atonalität angekommen ist – und die trotzdem dank ihrer Farbigkeit, Frische und Fantasie unmittelbar zugänglich klingen.
Arnold Schönberg – Kammersinfonie Nr. 1 op. 9 | Cristian Măcelaru | WDR Sinfonieorchester
Eine verhängnisvolle Affäre

Bildnis „Mathilde Schönberg als Halbfigur“ von Richard Gerstl (1907) | Bildquelle: picture alliance / akg
Es war ein Aufbruch ins Neuland, dessen Kühnheit wir im historischen Abstand nur noch erahnen können. Und diese Leistung ist umso erstaunlicher, wenn man weiß, welchen familiären Belastungen Schönberg zeitgleich ausgesetzt war. Denn der junge Maler Richard Gerstl war in das Leben des Ehepaars Schönberg getreten. Er gab Schönberg, der gerade die Malerei als Ausdrucksform für sich entdeckte, Unterricht, wurde für ihn zum Freund, zum Seelenverwandten – und verliebte sich gleichzeitig in Schönbergs Frau Mathilde, die ihm Modell stand. Beim gemeinsamen Urlaub 1908 am Traunsee eskalierte die Situation. Mathilde und Gerstl flohen, um ein neues Leben zu beginnen, Schönberg blieb perplex zurück. Schließlich konnte Mathilde zur Rückkehr bewegt werden, der Kinder wegen. Richard Gerstl verkraftete diese Wendung nicht; er nahm sich das Leben.
BR-KLASSIK-Dossier zu Arnold Schönberg
Unser großes Schönberg-Dossier – hier finden Sie Hintergründe, Geschichtliches, Konzertvideos, Übertragungen im Radio und vieles mehr.
Geheime Programme
Auch Schönberg war nun in höchstem Maße suizidgefährdet, worauf mehrere Testamente aus dieser Zeit hindeuten. Aber es gelang ihm, das Geschehen in seiner Musik zu verarbeiten: am offensichtlichsten in den Einaktern „Erwartung“ und „Die glückliche Hand“, verklausuliert im Zweiten Streichquartett (das im Scherzo die Melodie „Oh du lieber Augustin, alles ist hin“ zitiert) – und womöglich auch noch in dem einen oder anderen Stück, das wir heute als absolute Musik hören. Denn Schönberg wollte den Künstler vom Privatmenschen trennen und hielt daher außermusikalische Inspirationen geheim.
Schönbergs Empfindung ist von versengender Glut.
Anton Webern
Nur in wenigen Fällen, und dann oft nur im kleinen Kreis, hat er über programmatische Einflüsse gesprochen – etwa im Fall des Ersten Streichquartetts oder auch des späten Streichtrios, in dem er eine dramatische Nahtoderfahrung nachzeichnete. Aber das bedeutet nicht, dass es sich bei den übrigen Instrumentalkompositionen um abstrakte Musik gehandelt hätte. „Schönbergs Empfindung ist von versengender Glut“, schrieb schon sein Schüler Anton Webern; seine Musik wurzle „ausschließlich im Ausdrucksbedürfnis“.
Die Erfindung der Zwölftonmusik
Arnold Schönberg war im Herzen ein Kind der Romantik. Und so belastete es ihn immens, dass mit dem Verlust der Tonalität, den er mit herbeigeführt hatte, auch die damit verbundenen traditionellen Regeln und Formen ihren Sinn verloren hatten. Diese ästhetische Krise führte ihn an den Rand des Verstummens. Zwischen 1916 und 1920 stellte er das Komponieren sogar fast völlig ein. Bis er glaubte, die Lösung des Problems gefunden zu haben: die „Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“, kurz: die Zwölftonmusik. Ihr Zweck: den regellosen Wildwuchs der nicht-tonalen Musik wieder in geordnete Bahnen zu lenken.
Was ist die Zwölftontechnik?
Bevor ein Komponist ein Stück zu schreiben begann, sollte er sich nun erstmal eine sogenannte „Reihe“ überlegen: eine individuelle Folge von zwölf Tönen, in der jeder Ton der chromatischen Skala genau einmal vorkam (wäre ein Ton mehrmals vorgekommen, hätte er ja ein Übergewicht gehabt, wie in der tonalen Musik; das galt es zu vermeiden). Aus dieser Grundreihe wurden drei weitere Formen abgeleitet: der Krebs (die Reihe rückwärts), die Umkehrung (die Reihe an einer Notenlinie gespiegelt) und die Umkehrung des Krebses. Diese vier Formen konnten zudem auf jede beliebige der zwölf chromatischen Tonstufen transponiert werden. So entstand ein Vorrat von 48 Gestalten der Reihe, aus denen sich der Komponist für sein Stück bedienen konnte – eine ziemlich große Auswahl und doch nicht beliebig. Das Publikum brauchte das alles übrigens gar nicht zu wissen. Schönberg wollte überhaupt nicht, dass man die Reihe beim Hören nachvollziehen konnte. Ihm ging es allein darum, dem Komponisten eine Art Werkzeugkasten zur Verfügung zu stellen, mit dem dieser auch jenseits der traditionellen Harmonielehre wieder handwerklich sauber arbeiten konnte.
Schönbergs andere Erfindungen

Arnold Schönbergs Zwölfton-Reihenschieber | Bildquelle: © Arnold Schönberg Center, Wien
Den Erfindergeist, der sich in der Zwölftontechnik zeigt, hat Schönberg übrigens auch in vielen anderen Lebensbereichen ausgelebt. Was hat er nicht alles ausgetüftelt: eine Notenschreibmaschine, ein Schachspiel für vier Personen, einen Bibliotheksstuhl (mit Leiter statt Lehne), ein Schriftsystem, um Tennis-Spielzüge aufzeichnen, eine Umsteigefahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr und – sehr zum Leidweisen seiner Kinder – sogar ein Regelwerk fürs Geschirrspülen. Manches davon war tatsächlich nah an der Patentreife, manches einfach nur kurios. Und nichts hatte auch nur annähernd dieselbe durchschlagende Wirkung wie die Zwölftontechnik. Mit ihr, glaubte Schönberg, habe er „die Vorherrschaft der deutschen Musik für die nächsten hundert Jahre gesichert“. Und hatte damit nicht mal so unrecht: Schönbergs Erfindung zwang zur Auseinandersetzung, auch wenn man ihr nicht folgte. Die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts wäre ohne ihn anders verlaufen.
Die Wiener Schule
Arnold Schönberg war knapp 50, als er die Zwölftonmethode formulierte, und kam nun langsam in den Genuss der öffentlichen Anerkennung, nach der er sich immer gesehnt hatte. Furtwängler dirigierte seine Orchestervariationen, Puccini lobte seinen „Pierrot lunaire“, die Universal Edition ehrte ihn mit einer Festschrift. Er galt als charismatischer Lehrer, ehrfürchtig verehrt von seinem Wiener Schülerkreis rund um Alban Berg und Anton Webern. Und schließlich wurde er als Nachfolger von Ferruccio Busoni zum Kompositionsprofessor nach Berlin berufen. Die Widerstände, gegen die er zeitlebens angekämpft hatte, schienen endlich überwunden. Doch dann kam Adolf Hitler an die Macht.
Schönberg flüchtet vor Nazis in die USA

Arnold Schönberg, Zeichnung von Egon Schiele, 1917 | Bildquelle: picture-alliance/akg
Schönberg wurde nicht nur als moderner – im Nazi-Sprech „entarteter“ – Künstler angefeindet, sondern vor allem als Jude in seiner Existenz bedroht. Schon in Österreich hatte er den Aufstieg des Antisemitismus miterleben müssen. Als sich nun die Situation zuspitzte, er seine Professur verlor und ihm sein Schwager Rudolf Kolisch in einem Telegramm verklausuliert zu „Luftveränderung“ riet, flüchtete er im Mai 1933 Hals über Kopf aus Deutschland, zuerst nach Frankreich, dann im Oktober in die USA. Damit hatte er sein Leben gerettet – und musste doch mit fast 60 noch einmal ganz von vorne beginnen. Los Angeles wurde seine neue Heimat, wo er bis zur Pensionierung an der University of California unterrichtete. Trotzdem musste er Privatschüler und Auftragswerke annehmen, um finanziell über die Runden zu kommen.
Schönberg und das Judentum
Viele seiner späten Werke lassen sich als Stellungnahmen zu den Ereignissen in Deutschland und Europa lesen. Der bisher stets unpolitische Schönberg komponierte jetzt mit der „Ode an Napoleon“ eine flammende Stellungnahme gegen Hitler, er besann sich auf seine jüdischen Wurzeln, komponierte ein „Kol Nidre“ für den Gebrauch in der Synagoge, arbeitete an seinem Oratorium „Die Jakobsleiter“ weiter, schrieb das Schauspiel „Der biblische Weg“, in dem es um die Gründung eines jüdischen Staates geht. Als er nach dem Krieg erfahren musste, dass sein Bruder und sein Cousin von den Nazis ermordet worden waren, komponierte er in tiefer Betroffenheit ein Stück über den Holocaust: „Ein Überlebender aus Warschau“.
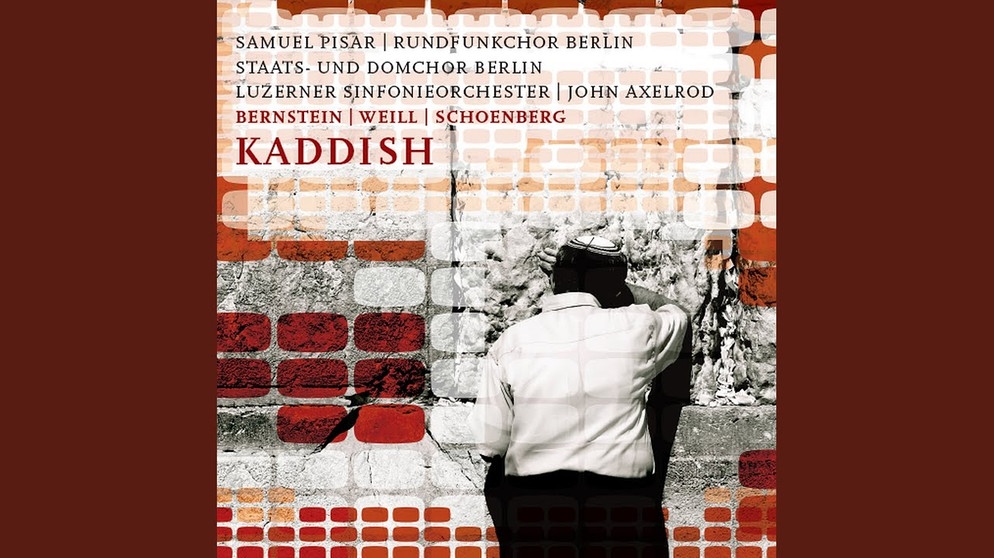
Ein Überlebender aus Warschau
Schönbergs Musik
Es ist ein Gänsehaut-Stück. Den Moment, wenn der Chor der Juden, den Tod in der Gaskammer vor Augen, das „Schma Jisrael“ anstimmt, wird kein Hörer und keine Hörerin jemals wieder vergessen. In ihrer packenden, unmittelbaren Zugänglichkeit ist diese Komposition allerdings eine Ausnahme in Schönbergs Oeuvre. Schon Alexander Zemlinsky, der Schönbergs erste Gehversuche als Komponist begleitet hatte, hatte den Finger in die Wunde gelegt: „Ich glaube, vieles ist zu überladen.“ Die komplexe Polyphonie, die vielen Mittelstimmen, die dichte Instrumentierung – sie sind geradezu ein Markenzeichen von Schönbergs Musik und erschweren den Zugang. Selten ist es für das Publikum Liebe auf den ersten Blick. Vieles erschließt sich erst bei mehrmaligem Hören – dann aber seinem ganzen Reichtum. Bei jeder Begegnung lässt sich wieder etwas anderes entdecken, satthören wird man sich an Stücken wie den „Variationen für Orchester“ oder dem Klavierkonzert nicht so schnell. Im Grunde also ist Schönberg die ideale Musik für die berühmte einsame Insel.
Schönbergs Bearbeitungen
Übrigens ist ein Großteil dieser Musik gar nicht zwölftönig; gerade in seinen späten Jahren ist Schönberg immer mal wieder zur Tonalität zurückgekehrt. Und er hat zahlreiche Werke der Vergangenheit neu bearbeitet: Kammermusik von Brahms, Orgelmusik von Bach, Lieder von Schubert, ein Concerto grosso von Händel, sogar Walzer von Johann Strauß oder das neapolitanische Lied „Funiculì, Funiculà“, das heute als Faschingsschlager bekannt ist.
Die Angst vor der 13
Schönberg war also keineswegs die miesepetrige Spaßbremse, als die er oft dargestellt wird. Der angebliche Hohepriester der schrägen Klänge begeisterte sich in Wirklichkeit für Boxkämpfe und spielte leidenschaftlich gern Tennis – am liebsten gegen seinen Freund George Gershwin. Und selbst, wenn er tief in der Arbeit steckte, ließ er es sich nicht nehmen, für die Familie zu kochen – mit allerdings zwiespältigen Folgen: Wenn es den Kindern schmeckte, konnte es wochenlang dasselbe Gericht geben … Nur bei einer Sache verstand Arnold Schönberg absolut keinen Spaß: bei der Zahl 13. Er war in höchstem Maße abergläubisch, benannte seine Oper sogar „Moses und Aron“ (statt korrekterweise „Aaron“), um zu vermeiden, dass der Titel 13 Buchstaben umfasste. Bizarrerweise sollte er mit seiner Furcht recht behalten: Arnold Schönberg starb an einem Freitag dem 13., 13 Minuten vor Mitternacht. Sein letztes Wort lautete: „Harmonie“.










