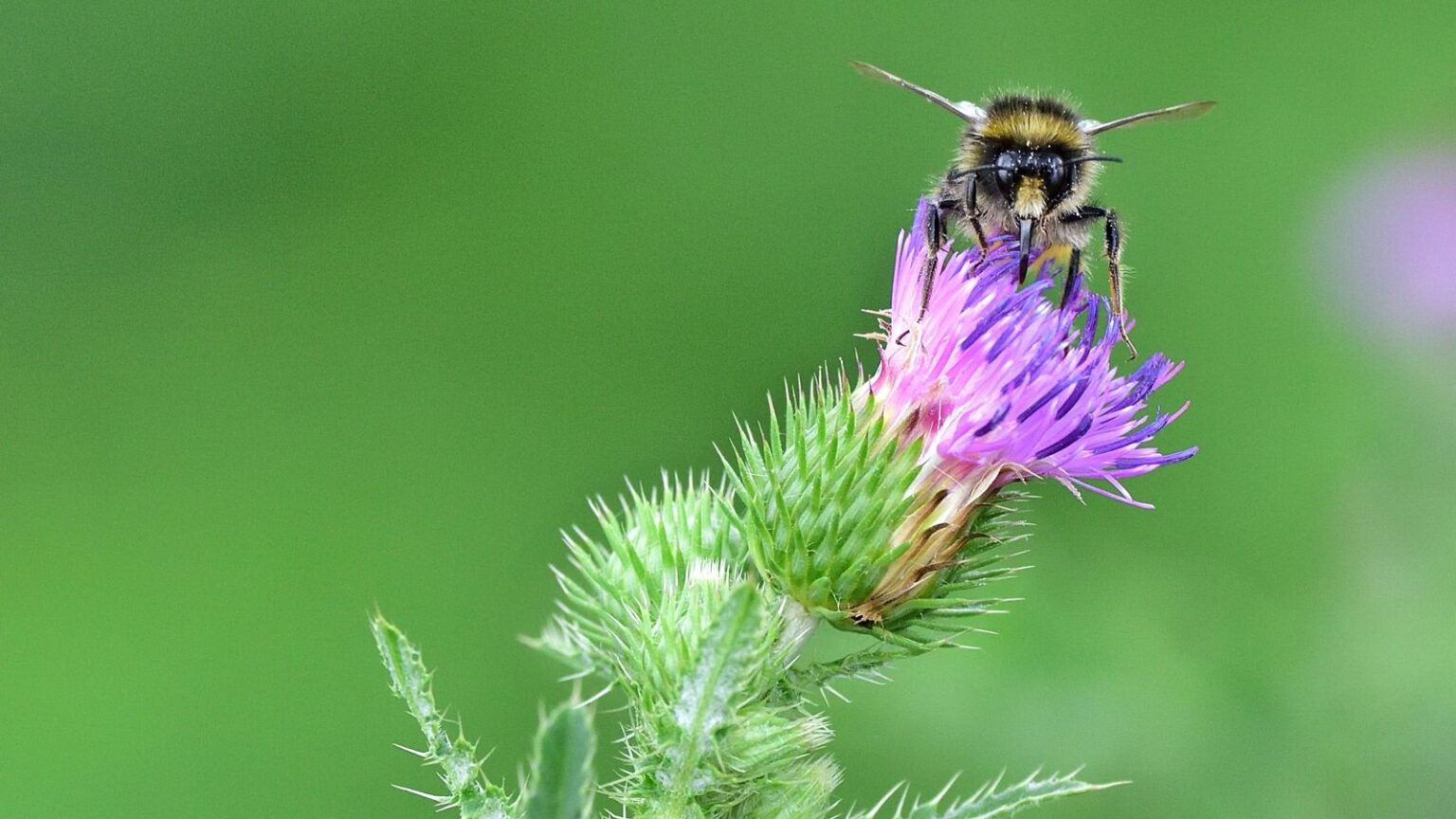„Rettet die Bienen“ war das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Bayerns. Als Reaktion erklärte die bayerische Staatsregierung, sie wolle, „den Artenschutz zu einem gesamtgesellschaftlichen Projekt machen“. Am 17. Juli 2019 wurde das Gesetz zum Volksbegehren Artenschutz beschlossen.
In ihrer Zwischenbilanz haben die Initiatoren des Volksbegehrens Artenvielfalt nun ein gemischtes Fazit gezogen. Während sie in einigen Bereichen Fortschritte feststellen, sehen sie etwa beim Biotopverbund große Mängel.
Naturschutzverbände beklagen: Biotopverbund ist nicht erkennbar
Bis 2030 sollen mindestens 15 Prozent der bayerischen Offenlandfläche als Biotopverbund funktionieren. Das heißt, Lebensräume müssen so vernetzt werden, dass Tiere und Pflanzen von einem Lebensraum in einen anderen für sie passenden Lebensraum wechseln können. Markus Erlwein vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern, der Pressesprecher des Volksbegehrens Artenvielfalt, kritisiert: „Da ist es bisher völlig unklar, wie das passieren soll.“
Schulterklopfen bei der Staatsregierung
Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern hatte bereits letzte Woche zusammen mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) Bilanz gezogen. Sein Fazit: „Drei Jahre Artenschutz auf Top-Niveau.“ Rund 80 Prozent der Maßnahmen seien bereits erledigt, so Glauber und Kaniber. In ihrer Liste der umgesetzten Maßnahmen steht auch der Ökolandbau, der in Bayern derzeit knapp 13 Prozent an der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmacht.
Viel Luft nach oben im Ökolandbau
Tatsächlich hat sich der Ausbau des Ökolandbaus laut wissenschaftlicher Bewertung verschlechtert. Im Gesetz zum Volksbegehren heißt es, dass der Anteil des Ökolandbaus bis 2030 bei 30 Prozent liegen soll. Und von 13 Prozent, Stand heute, bis 30 Prozent Ökolandbau ist es noch ein weiter Weg. Bei den staatseigenen landwirtschaftlichen Flächen sollte der Anteil der Bioflächen schon seit dem Jahr 2020 30 Prozent ausmachen. Tatsächlich liegt er bei 18 Prozent. Die Daten wurden hauptsächlich durch Landtagsanfragen erhoben.
Die ÖDP-Landesvorsitzende Agnes Becker kritisiert deshalb Landwirtschaftsministerin Kaniber für ihre wiederholte Aussage, Bayern sei deutschlandweit Vorreiter beim Ökolandbau. Diese Aussage sei „peinlich und bewusst irreführend“, findet Becker und verweist darauf, dass andere Bundesländer beim Anteil der Ökolandwirtschaft bereits weiter seien. Allerdings hat Bayern als Flächenland in Summe die meisten ökologisch bewirtschafteten Hektare.
Maßnahmen für weniger Pflanzenschutzmittel-Einsatz fehlen
Weitere Schwachstellen: Die Datengrundlagen, um beurteilen zu können, wie erfolgreich bestimmte Maßnahmen sind, seien „sehr schwammig“ und es gäbe bisher keine Ansätze, um den Pestizideinsatz bis 2028 zu halbieren, wie es sich die Staatsregierung vor drei Jahren vorgenommen hat. „Da fehlt momentan jeder politische Wille“, so Erlwein vom LBV.
Großes Lob für Streuobst-Pakt und Naturwaldflächen
Andere Maßnahmen werden von den Naturschutzverbänden gut geheißen: So bewerten sie zum Beispiel positiv, dass die Zahl der für den Artenschutz so wichtigen Streuobstbäume zugenommen hat. Den Streuobstpakt, mit dem für 600 Millionen Euro eine Million neue Obstbäume gepflanzt werden sollen, bezeichnet der Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz (LVB) Norbert Schäffer sogar als Erfolgsgeschichte: „Der Streuobstpakt hat auf eine beeindruckende Art und Weise gezeigt, wie Naturschutz funktioniert, wenn alle an einem Strang ziehen“, so Schäffer.
Dass 60.000 Hektar Staatswald aus der Nutzung genommen wurden und nun 50 Biodiversitätsberater an den bayerischen Landratsämtern arbeiten, begrüßt Erlwein als Pressesprecher des Volksbegehrens. Zusätzlich wurde an jedem Landwirtschaftsamt ein Berater oder eine Beraterin für Wildlebensräume eingestellt. Den Streuobstpakt bezeichnet Erlwein sogar als „großen Wurf“. Hier seien alle Akteure einbezogen worden und es sei umgesetzt worden, was alle erreichen wollen.
Bauernverband: Kommunen und Wirtschaft sollen auch Artenschutz betreiben
Der Bayerische Bauernverband findet den Streuobstpakt auch gut, insbesondere, weil diese Maßnahmen alle auf freiwilliger Basis laufen. Der Bauernverband hat allerdings auch einiges zu kritisieren. Vor allem, dass bisher nur die Landwirtschaft zu Maßnahmen verpflichtet worden sei und andere Gesellschaftsgruppen keinen Beitrag zu diesem Volksbegehren leisten müssten, so Stefan Köhler, der Umweltpräsident des BBV – zum Beispiel die Kommunen, die Wirtschaft, die Kirchen. Es gäbe zwar einen Blühpakt, „aber es wird alles so halbherzig angegangen“.
Der Blühpakt soll Kommunen, Betriebe und Organisationen dazu anregen, nektar- und pollenreiche Blumen auf Grünflächen zu etablieren und insektenschonend zu pflegen.
Gute Noten für Randstreifen an Gewässern
Im Gesetz zum Volksbegehren steht zum Beispiel auch, dass Landwirte am Gewässerufer einen fünf Meter breiten Streifen nicht mehr als Acker, sondern nur noch als Grünland nutzen können. Dafür bekommen sie einen finanziellen Ausgleich. Wiesen, die größer sind als ein Hektar, dürfen nicht mehr von außen nach innen gemäht werden, damit zum Beispiel Rehkitze, Hasen und Igel noch flüchten können. Und zehn Prozent der Wiesen sollen erst nach dem 15. Juni zum ersten Mal gemäht werden, damit Kräuter zum Blühen kommen. Der Anteil liegt derzeit bei knapp über sieben Prozent.
Tatsächlich bekommt die Förderung von Gewässerrandstreifen sowie der Grünen Bänder und Blühstreifen und die Förderprogramme für Weidetierhalter von der Hochschule Nürtingen gute Noten.
Dauerthema Walzverbot
Welche Maßnahme des Artenschutz-Volksbegehrens hat die Arbeit auf den landwirtschaftlichen Betrieben am stärksten verändert? Das Walzverbot auf Wiesen nach dem 15. März, sagt BBV-Umweltpräsident Stefan Köhler. Das heißt, die Bauern dürfen ihre Wiesen jetzt in der Regel nach dem 15. März nicht mehr walzen, damit Bodenbrüter, Amphibien und zum Beispiel Heuschrecken geschützt werden. Für Ausnahmen sind die Regierungsbezirke zuständig. Wenn am 15. März noch Schnee liegt oder der Boden zu nass ist – dann darf auch noch später gewalzt werden.
Große Unterschiede von Kommune zu Kommune
Tschüss, Wiesenlabkraut, Braunelle und Schafgarbe! Auch im Juli 2022 werden in bayerischen Kommunen die Nektarpflanzen von Taubenschwänzchen, Gartenhummel und Perlmuttfalter mit dem Freischneider in tausend Stücke gehäckselt. Im Öffentlichen Grün ist die Förderung der Artenvielfalt offenbar noch nicht überall Standard.
Unterm Strich jedoch – so Alois Glück, der vor drei Jahren zwischen den verschiedenen Interessen am Runden Tisch Artenvielfalt vermittelt hat – seien die Forderungen des Volksbegehrens in vielen Bereichen sehr gut umgesetzt worden. Im kommunalen Bereich hänge der Stellenwert der Artenvielfalt stark vom jeweiligen Landkreis oder der Gemeinde ab.
Vermittler Alois Glück: Gemischte Bilanz
Deswegen bräuchte es hier künftig noch mehr Zusammenarbeit zwischen Innenministerium, Umweltministerium, Städtetag, Landkreistag und Gemeindetag, sagt Glück. Dem ehemaligen Landtagsmitglied der CSU ist die Umwelt schon lange ein wichtiges Anliegen. Sein Fazit: Es habe sich viel getan. Aber gleichzeitig sei nicht alles ideal. Und mit der Zeit stelle man fest, „da gibt’s noch enormen Verbesserungsbedarf, beispielsweise im kommunalen Bereich“.
Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst am 17.7.2022. Er wurde aus technischen Gründen am 16.4.2025 erneut publiziert. Der Artikel enthält keine neuen Erkenntnisse.
Zum Artikel: BR24live: Bayern drei Jahre nach „Rettet die Bienen“