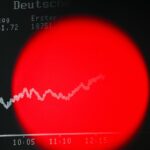Den Namen Hans Kammler muss man sich merken. Von Haus aus Bauingenieur und Architekt und in einer führenden Position in der SS, war er von 1941 an verantwortlich für den Bau der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Zwei Jahre später übernahm Kammler die Leitung der unterirdischen Fabriken für Flugzeuge und Raketen, also auch des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora bei Nordhausen.
Die dunkle Figur hinter Wernher von Braun
Dort, im Norden von Thüringen, mussten Zwangsarbeiter unter schrecklichsten Bedingungen die angeblichen Wunderwaffen montieren. Hans Kammler war einer der Hauptverbrecher aus Deutschland – und gleichzeitig die dunkle Figur hinter Forschern wie Wernher von Braun. Steffen Kopetzkys Roman „Atom“ zeigt Kammler in genau dieser Rolle.
„Leute wie Kammler, die alles organisiert und durchgeführt haben, kennt man eben nicht so“, sagt der Schriftsteller aus Pfaffenhofen/Ilm. „Kammler ist einer der Herausragenden, mit einer einzigartigen Machtfülle. Aufgrund seiner organisatorischen Erfolge hat er eine Position nach der anderen Position an sich gezogen. Bis er dann am Ende des ‚Dritten Reichs‘, wahrscheinlich, vermutlich – so sagen das die Historiker – der handlungsmächtigste Mann war.“
Von Weimar zum Großen Terror unter Stalin
Hans Kammler taucht erst vergleichsweise spät auf in Steffen Kopetzkys Roman. Die Geschichte beginnt in den letzten Jahren der Weimarer Republik und erzählt zunächst von den drei zentralen Figuren. Alexander „Sascha“ Scherschewsky, Hedwig von Treyden und Simon Batley begegnen einander in Berlin, sie besuchen die Vorlesung von Albert Einstein und erleben die Premiere von Fritz Langs Film „Frau im Mond“, über die Eroberung des Weltraums.
Simon Batley – wie Hedwig von Treyden eine erfundene Figur – ist da bereits im Auftrag des britischen Geheimdienstes unterwegs. Er soll den aus der Sowjetunion stammenden Alexander Scherschewsky ausspionieren. Dieser, eine reale Figur, fällt 1937 dem Großen Terror unter Stalin zum Opfer. „Danach folgte die sogenannte ‚Enthauptung‘ der Roten Armee“, erklärt Steffen Kopetzky. „Der Tod von viereinhalb bis fünftausend Offizieren der Roten Armee. Scherschewsky war der erste.“