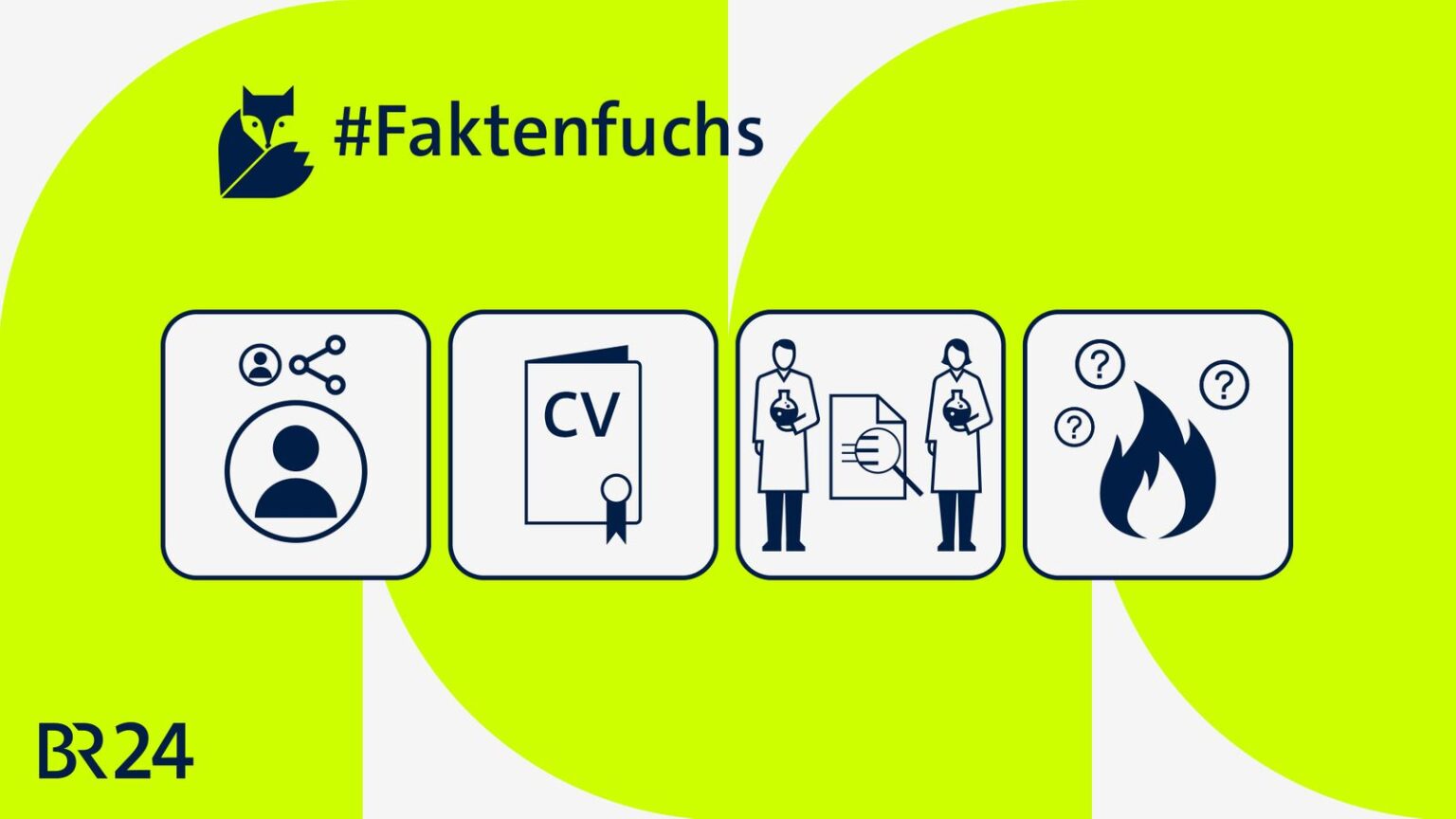Es ist eine bekannte Desinformations-Strategie, mit vermeintlich wissenschaftlichen Studien Zweifel an echten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu streuen. Dieser #Faktenfuchs erklärt, wie Sie Pseudowissenschaft von seriöser Wissenschaft unterscheiden können.
Denn Pseudowissenschaft wird mittlerweile sogar von der derzeitigen US-Regierung verbreitet. Sie versucht damit gezielt, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Medizin oder der Klimaforschung in Zweifel zu ziehen.
- Wie die Trump-Regierung mit Pseudowissenschaft ihre Agenda legitimiert, lesen Sie hier.
Pseudowissenschaft nutzt Vertrauenswürdigkeit echter Wissenschaft aus
Warum Pseudowissenschaft als Desinformations-Strategie genutzt wird, weiß Isabella Peters vom Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern forschte sie im von der Bundesregierung geförderten Projekt „DESIVE2“ zu wissenschaftlich anmutender Desinformation. Sie schreibt auf #Faktenfuchs-Anfrage, Informationen, die vermeintlich aus dem Wissenschaftsbetrieb kommen, gelten als sehr vertrauenswürdig. „Dies macht sich die Pseudowissenschaft und die wissenschaftliche Desinformation zunutze, um die Menschen (absichtlich) zu täuschen“, so Peters.
Vier Tipps, anhand derer man Pseudowissenschaft erkennt
Diese Tipps können dabei helfen, Wissenschaft von Pseudowissenschaft zu unterscheiden:
1) Wer verbreitet die Info?
Isabella Peters rät dazu, „eine kritische Haltung gegenüber Informationen einzunehmen, die nicht von Quellen kommen, denen man weitläufig wegen ihrer Vorgehensweise und Finanzierung Vertrauen schenken kann“. Man müsse sich immer fragen: Woher stammt eine Information und wer profitiert von ihrer Verbreitung?
Ein von der Trump-Regierung in Auftrag gegebener Bericht über die Erderwärmung aus dem Jahr 2025 wurde zum Beispiel von Autoren verfasst, die eine Nähe zu Think-Tanks aufweisen, die schon seit Jahren daran arbeiten, öffentlich den Klimawandel zu leugnen.
Stephan Lewandowsky, Kognitionspsychologe an der Universität Bristol, sagt im #Faktenfuchs-Interview: „Letztlich geht es darum, wem man vertraut.“
Eine vertrauenswürdige Webseite erkennt man etwa daran, ob sie ein Impressum mit einer gültigen Anschrift hat. Ob eine Seite Quellen und Belege anführt, kann ein weiteres Anzeichen sein.
Noch ein Hinweis auf die Glaubwürdigkeit einer Quelle ist es, wenn sie mit Unsicherheiten oder Fehlern transparent umgeht. Auch eine kurze Internetrecherche über die Finanzierung einer Quelle ist nützlich.
Weitere Tipps dazu, was eine Quelle glaubwürdig macht, lesen Sie hier.
2) Ist der Autor wirklich Experte auf dem Gebiet?
Toralf Staud, Mitgründer des Portals klimafakten.de, sagt: „Wenn ein Quantenphysiker sich zu den Gründen des Klimawandels meldet, ist das sicherlich eine interessante Meinungsäußerung, aber fachlich erstmal mit Vorsicht zu genießen“. Ein Hinweis auf Expertise sei es, wenn jemand noch mehr Artikel zum Thema in einer seriösen, wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht hat. Ob eine Fachzeitschrift wissenschaftlich arbeitet, erkennt man in der Regel an einem weiteren Merkmal: dem sogenannten Peer-Review.
3) Wurde die Publikation einem Peer-Review-Prozess unterzogen?
In einem Peer-Review überprüfen Fachexperten vor der Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Artikels, ob der Autor des Artikels wissenschaftlich sauber gearbeitet hat. Unzulängliche Arbeiten müssen nachgebessert werden oder werden abgelehnt. Staud sagt: „Es gibt mittlerweile Fake Journals, deren Layouts und Namen wissenschaftlich klingen. Die kann man dafür bezahlen, dass man da alles veröffentlichen kann.“ Auch die veröffentlichenden Zeitschriften müsse man sich also genau anschauen.
Wie sich die Qualität von Studien und Fachzeitschriften unterscheidet, lesen Sie hier.
4) Klingt etwas zu revolutionär, um wahr zu sein?
Isabella Peters konstatiert: „Es ist einfach sehr schwer bzw. mit reichlich Rechercheaufwand verbunden, pseudowissenschaftliche Desinformation oder wissenschaftliche Falschinformation zu erkennen“. Häufig sei dafür eine gewisse Fachexpertise notwendig.
Toralf Staud gibt einen einfachen Tipp, der dennoch helfen kann. Dass eine einzelne Studie den Stand der Forschung „über den Haufen wirft“, komme vor, „ist aber echt selten“, sagt er. Staud vergleicht wissenschaftliche Erkenntnisse mit einem Mosaik: „Wenn sich in diesem großen Mosaik von wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Studie als falsch herausstellt, nehme ich dieses Mosaiksteinchen raus – aber das Gesamtbild des Puzzles ist immer noch da“. Klinge das vermeintliche Ergebnis einer Studie besonders revolutionär, sollte das erstmal skeptisch machen, so Staud.
Hinter pseudowissenschaftlicher Desinformation stecken häufig organisierte Interessen. Früher verfolgte sie etwa die Tabakindustrie, um Zweifel an den gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Rauchens zu streuen, so Staud.
Fazit
Es ist eine bekannte Desinformations-Strategie, mit pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen oder Statistiken Zweifel an anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu streuen. Diese Strategie nutzt das hohe Vertrauen aus, das die Wissenschaft in der Bevölkerung genießt.
Pseudowissenschaftliche Desinformation ist besonders schwer zu erkennen. Einige Fragen können dabei helfen, sie zu entlarven: Wer verbreitet die Studie? Wer hat sie geschrieben? Wurde sie in einer seriösen wissenschaftlichen Zeitschrift publiziert? Klingen die Erkenntnisse zu außergewöhnlich, um wahr zu sein?