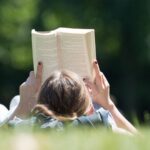Die deutsche Pflegeversicherung hat ein doppeltes Problem: Sie schafft es zum einen nicht, pflegebedürftige Menschen und ihre Familien wirklich aufzufangen und sie ist zum anderen chronisch unterversorgt. Wobei letzteres – dass Geld fehlt – wiederum dazu führt, dass die Hilfe bei vielen Bedürftigen zu gering ausfällt.
Konkret zeigt sich das zum Beispiel daran, dass Menschen, die in Heimen untergebracht werden müssen, im ersten Jahr rund 3.000 Euro pro Monat aus eigener Tasche zuzahlen müssen, weit mehr als das durchschnittliche Alterseinkommen in Deutschland. Es braucht also entweder mehr Einnahmen im Pflegesystem, oder eine bessere Steuerung der Ausgaben.
Warum so viel Geld in der Pflegeversicherung fehlt
Der Bundesrechnungshof beziffert die Finanzlücke bis 2029 auf 12,3 Milliarden Euro. Das liegt einmal daran, dass die Zahl der Pflegebedürftigen zuletzt stark gestiegen ist. Ende vergangenen Jahres waren es rund 5,6 Millionen Menschen, etwa 400.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. Außerdem sind die Zahlungen, die Pflegebedürftige erhalten, angehoben worden. Die Pflegekassen kritisieren, dass die Finanzlücke auch durch Zusatzkosten während der Corona-Pandemie entstanden sei, etwa wegen Prämien für Pflegekräfte oder wegen Corona-Tests. Demnach schuldet der Bund den Kassen rund sechs Milliarden Euro – das wäre schon fast die Hälfte des mittelfristigen Defizits.
Sparen in der Pflege – aber wo?
Theoretisch könnte man überlegen, ob zu viele Menschen derzeit als pflegebedürftig gelten und hier härtere Kriterien anlegen. Allerdings hatte man vor einigen Jahren den Kreis der Berechtigten bei den Pflegestufen bewusst erhöht, um beispielsweise Menschen mit einer beginnenden Demenz auch zu versorgen. Fraglich, ob man das nun wieder zurückdrehen sollte und wie groß der Effekt dadurch überhaupt wäre.
Möglich wäre auch zu versuchen, die Löhne und Gehälter des Pflegepersonals zu drücken. Aber den ohnehin schon herrschenden Pflegenotstand würde man so wohl eher auf die Spitze treiben. Oft greifen Sparvorschläge zu kurz. Viele Experten konzentrieren sich deshalb eher auf die Einnahmenseite.
Mehr Geld für die Pflege durch höhere Beiträge
Das Einfachste wäre, die Beitragsätze zu erhöhen. Das ist zuletzt auch passiert: Zum Jahreswechsel hat die dafür zuständige Bundesregierung den Satz um 0,2 Prozentpunkte angezogen, auf 3,6 Prozent. Kinderlosen wird seit diesem Jahr 4,2 Prozent ihres Bruttolohnes für die Pflege berechnet. Wobei sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer diese Zahlungen teilen. Deshalb ist auch die Wirtschaft strikt dagegen, dass die Beiträge weiter erhöht werden. Die Unternehmen würden schon jetzt unter den zu hohen Lohnnebenkosten ächzen, zu denen eben auch die Pflegebeiträge gehörten. Aber auch viele Versicherte dürften zusätzliche Abschläge vom Lohn wohl schmerzen.
Alle sollen „solidarisch“ in die Pflegeversicherung einzahlen
In Fachdebatten fällt immer wieder das Schlagwort „Pflege-Bürgerversicherung“. Gemeint ist damit vor allem, dass möglichst alle Menschen einzahlen, insbesondere auch Personen, die sich bislang über private Pflegeversicherungen absichern können. Außerdem wird vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben, beispielsweise auf den Wert der Rentenversicherung. Das wäre eine Erhöhung um rund die Hälfte auf 96.600 Euro jährlich. Und das hieße: Nur Einkommen, die darüber liegen, werden nicht mehr für die Pflegeversicherung herangezogen.
Noch radikaler wäre, die Beitragsbemessungsgrenze völlig abzuschaffen, sodass Reichere mit ihren kompletten Einkommen einzahlen müssten und nicht nur mit einem Teil. Auch Kapitalerträge könnten mit einbezogen werden. Innerhalb der schwarz-roten Koalition sind solche Ideen, die unter dem Begriff Bürgerversicherung laufen, aber umstritten: Die Union lehnt sie klar ab. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD konnte man sich lediglich auf eine moderate Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze einigen.
Kurzfristige „Steuer-Pflaster“ verbessern die Lage der Pflege kaum
Anders als Krankenkassen können Pflegeklassen nicht Pleite gehen. Zur Not springt der Staat mit Steuergeldern ein. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant deshalb derzeit für die Jahre 2025 und 2026 Darlehen von insgesamt zwei Milliarden Euro für die Pflege ein. Damit können die Probleme laut Bundesrechnungshof aber nur notdürftig zugepflastert werden. Eine eigentlich dringend nötige Entlastung bei den Zuzahlungen, wie sie die SPD eigentlich will, kann nur durch eine grundlegende Reform erreicht werden.