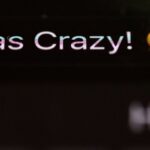Aussagen, die ein generativer Algorithmus, landläufig als Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet, trifft, speisen sich aus dem Material, mit dem er trainiert wurde. Der Algorithmus stellt daraufhin auf Grundlage von Regeln Verbindungen her und berechnet Wahrscheinlichkeiten, aus denen er eine Antwort formuliert. Er kann aber grundsätzlich nicht erkennen, ob das Ergebnis seiner Berechnungen ethischen Normen entspricht oder der Realität entspricht. So sind immer wieder Aussagen der KI, obwohl überzeugend dargeboten und auf den ersten Blick schlüssig, schlicht falsch. Fachleute sprechen davon, dass die KI halluziniert.
Musk-Firma xAI droht Ordnungsgeld
Das Landgericht Hamburg hat jetzt in einer einstweiligen Verfügung entschieden, dass für solche Falschaussagen die Herstellerfirma der KI haftbar gemacht werden kann. Der Fall: Die KI Grok der von Elon Musk gegründeten Firma xAI hatte fälschlicherweise behauptet, der Demokratie-Verein Campact e.V. werde mit Steuergeld finanziert. Für den Demokratie-Verein, der die private Spendenfinanzierung regelmäßig offenlegt, ist die Feststellung der finanziellen Unabhängigkeit von staatlichem Geld sehr wichtig.
Nach Androhung von Ordnungsgeld: Die KI hat gelernt
Deswegen hat Campact vor dem Landgericht gegen die Falschbehauptung der KI geklagt und eine einstweilige Verfügung erstritten: Wenn die KI ihre Behauptung weiterhin aufrechterhält, droht der Herstellerfirma xAI ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Das zeigte Wirkung: Auf die Frage, wie sich Campact finanziert, erklärt Grok jetzt: „Es gibt keine staatlichen Fördermittel, keine Parteispenden und keine Zuwendungen von Unternehmen oder Konzernen.“
Die Frage, wer behauptet habe, Campact werde mit Steuermitteln finanziert, beantwortet Grok unter anderem mit einer Liste von Urteilen, die der Verein gegen Journalisten, Politiker und Parteien bereits zuvor erstritten hatte. Darunter ist auch das jüngste Urteil des Landgerichts Hamburg gegen xAI und die Grok-Falschbehauptung.
Noch kein Präzedenzfall
Die einstweilige Verfügung ist aber nur ein Etappensieg für Campact. Denn eine Entscheidung im eigentlichen Gerichtsverfahren steht noch aus. Die einstweilige Verfügung ist nur ein schneller Schutz und soll verhindern, dass sich ein möglicher Schaden vergrößert. Erst wenn das Gericht ein Urteil gesprochen hat, könnte daraus ein juristischer Präzedenzfall werden, der eine Richtung aufzeigt, wie die Aussagen einer KI grundsätzlich zu bewerten sind und wer dafür haftet.
Abwägen gegen andere Schutzgüter
Denn das Gericht muss in dem Prozess abwägen, ob für die KI ähnliche Rechte und Pflichten gelten, wie beispielsweise bei der Meinungsfreiheit für natürliche Personen oder bei der Pressefreiheit. Die grundsätzliche Richtung deutet sich in der einstweiligen Verfügung aber an: Die Hersteller-Firma haftet für belegbar falsche Aussagen der KI, die sie programmiert hat.