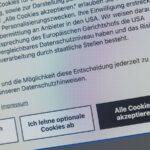Welche Auswirkungen haben Klimawandel, Ausbreitung des Menschen und Artensterben in Afrika? In München sind Umweltwissenschaftler von afrikanischen und europäischen Universitäten zu einem ersten Vernetzungstreffen zusammengekommen, um über ihre Projekte und Erfahrungen zu sprechen. Sie alle arbeiten im Exzellenzcluster „Africa Multiple“ der Universität Bayreuth (externer Link) zusammen.
Für Charles Kilawe ist die Sache klar: Als Wissenschaftler dürfe er sich nicht zurücklehnen und nur in der Forschung arbeiten. „Heute muss Wissenschaft mit praktischer Umsetzung verbunden werden“, fordert der Waldökologe von der Sokoine Universität für Landwirtschaft in Tansania.
Nachhaltiger Naturschutz muss für die Menschen da sein
Seit sechs Jahren versucht Kilawe, den Himmelblauen Zwergtaggecko vor dem Aussterben zu retten. Kilawe und sein Team können Erfolge nachweisen. Nicht nur sei die Geckopopulation, die nur auf einer 20 Quadratkilometer großen Fläche in Tansania lebt, um 40 Prozent angewachsen. Auch invasive Arten seien zurückgegangen und die Waldbrandgefahr sei durch die Aufforstung – die Geckos leben nur auf einer ganz bestimmten Baumart – drastisch gesunken.
Die Menschen vor Ort hätten auch Einbußen. Sie mussten Bauernhöfe aufgeben und es gebe durch mehr Wald auch mehr Affen, die wiederum Anbauflächen plündern. Aber die Vorteile würden überwiegen. Es gebe Jobs in Naturschutz, Tourismus oder Imkerei. Naturschutz müsse für die Menschen da sein. „Nur dadurch wird er nachhaltig“, ist Kilawe überzeugt.
Naturschutz funktioniert nur mit den Menschen vor Ort
Ohne die Menschen vor Ort gehe nichts. Das ist der zentrale Rat vieler Naturschützer und Wissenschaftler weltweit. Auch von Maano Ramutsindela, Umweltwissenschaftler an der Universität Kapstadt. Ihm gehe es um die soziale Gerechtigkeit: „Insbesondere, weil der Naturschutz in Afrika eine Geschichte der Vertreibung von Menschen zur Schaffung von Nationalparks hat.“
Großtiere wie Elefanten, Giraffen, Löwen und Geparden überleben zwar dank der Parks. Für den Arterhalt aber reicht das häufig nicht, etwa bei Geparden: Wenn die Gruppen zu klein werden, können sie keinen gesunden Nachwuchs zeugen. Die größte Gepardenpopulation lebt auf landwirtschaftlich genutzten Gebieten in Namibia und Botswana.
„Wenn Menschen daran gewöhnt sind, mit Tieren zusammenzuleben, und sich dabei wohlfühlen, ist das voll in Ordnung“, sagt Ramutsindela. Aber: „Niemand sollte gezwungen werden, mit diesen Tieren zusammenzuleben, wenn er das nicht möchte.“ Bei Großtieren zeigt sich der Konflikt zwischen Mensch und Umwelt besonders stark.
Artenschutz und Landwirtschaft in Einklang bringen
Unzählige kleine Arten, Insekten, Würmer, Spinnen oder Pflanzen, werden im Zuge industrieller Landwirtschaft verdrängt. Die Lösung hier könne nicht sein, dass Menschen Hunger leiden, warnt Ramutsindela. Stattdessen sollten Artenschutz und Landwirtschaft in Einklang gebracht werden.
Als Positivbeispiel nennt der Umweltwissenschaftler die traditionelle Landwirtschaft der Konso in Äthiopien. Trockensteinterrassen, gepflanzte Bäume und traditionelle Techniken sind mittlerweile von der UNESCO als Welterbe geschützt (externer Link). „Diese alltäglichen Bemühungen sollten wir wertschätzen, statt große Konzepte zu verfolgen, die in Schutzgebieten oft zu Leid führen“, ist Ramutsindela überzeugt.
Nachhaltiger Naturschutz: Herausforderungen und erfolgreiche Ansätze
Mensch und Natur in Einklang zu bringen, ist sehr viel schwieriger, als nur die Gemeinde vor Ort mit einzubeziehen, warnt Camille Jahel vom französischen Forschungsinstitut CIRAD. Dank eines großen Forschungsclusters an der Universität Bayreuth (externer Link) können sie, Ramutsindela, Kilawe und viele weitere Wissenschaftler weltweit sich vernetzen und zusammenarbeiten.
Damit Naturschutz wirklich nachhaltig funktioniert, müssen drei Dinge zusammenkommen: Die Menschen vor Ort müssen erstens davon profitieren und nicht ärmer werden. Zweitens müssen alle Faktoren langfristig gedacht sein, zum Beispiel, wenn ein Wald wiederentstehen soll: Wie lange brauchen Bäume zum Wachsen, wie viel Brennholz brauchen die Menschen – und wie lange brauchen Tiere, um sich auszubreiten? Und drittens: Nicht nur die Community, auch Politik, Wirtschaft – alle Menschen müssen zusammenarbeiten.
„Das klingt nach Idealismus, aber tatsächlich ist es in einigen wenigen Fällen passiert“, sagt Jahel. Sie tut sich schwer, das eine Positivbeispiel zu finden. Aber eines kommt sehr nah ran: In Niger haben Bauern entdeckt, dass Wälder von selbst zurückkommen, ganz ohne Aufforstung, nur indem Stümpfe gefällter Bäume sich selbst überlassen werden. Nach und nach sind Bauern, Politik und Umweltschützer aufeinander zugegangen – und der Wald ist zurückgekommen.