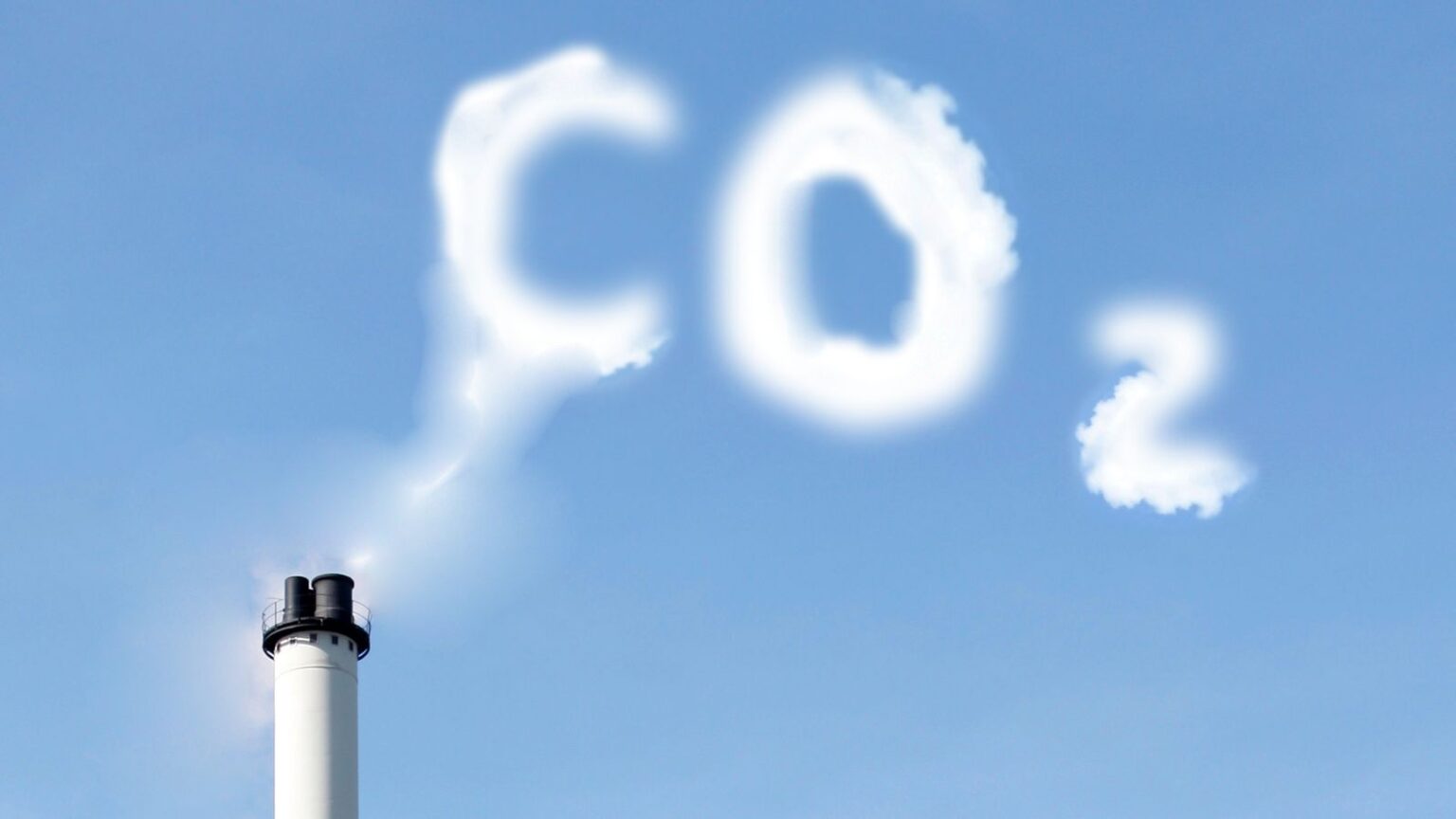Der Bundestag will heute eine Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes verabschieden, damit künftig die Speicherung von CO2 direkt im Boden ermöglicht wird. Denn zahlreiche Studien zeigen, dass ohne eine CO2-Speicherung das Ziel, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, nicht erreicht werden kann.
Vorgesehen sind ehemalige Gas- und Öl-Felder, Erdgasspeicher sowie salzwasserhaltige Gesteinsschichten, sogenannte „saline Aquifere“, tiefer als 800 Meter unter Grund. In ihnen soll das Kohlendioxid verpresst und sicher gelagert werden. Vor allem aus „unvermeidbaren Emissionen“. Dazu zählen bislang die der Zement- und Aluminium-Industrie sowie der Müllverbrennung.
Produktion als ’nicht vermeidbare Emissionen‘ deklariert
Das sei auch nötig, so der Geologe Christoph Hilgers vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Sonst könnten diese Wirtschaftssektoren nicht klimaneutral werden. Er begrüßt das Gesetz, da jetzt etwas voranginge. Dem stimmt auch Franziska Holz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin zu. Allerdings sieht sie auch, dass „verschiedene Sektoren sich positionieren und versuchen, Politikern zu sagen, wir gehören auch zu den ’nicht vermeidbaren Emissionen'“. Es bestünde die Gefahr, dass Unternehmen auf CO2-Speicherung setzen, anstatt CO2-freie Produktionsmethoden anzuwenden.
Hoher Energieverbrauch
Zudem, so Holz, wird bei der CO2-Speicherung, auch CCS (Carbon Capture and Storage) genannt, selbst viel Energie gebraucht. Beispielsweise muss das Klimagas mit hohem Druck in geeignete Erdschichten gepresst werden. Sie schätzt, dass zehn bis zwanzig Prozent der zu speichernden Emissionen durch den Speichervorgang selbst entstehen könnten. Daher lohnt sich CCS nicht für den Energiesektor, der effizienter mit Erneuerbaren Energien betrieben werden kann. Und käme eben nur infrage für Zement- und Aluminium-Produktion sowie Müllverbrennung, wo es keine Alternativen gibt.
24 Megatonnen CO2 ab 2045 verpressen
Studien zeigen (externer Link): Ab 2045 könnte es möglich sein, jährlich 24 Megatonnen (Millionen Tonnen) im Boden zu speichern. Zum Vergleich: Letztes Jahr betrug die gesamte Menge an freigesetztem CO2 in Deutschland 650 Megatonnen. Christoph Hilgers hält dennoch eine Speicherung für dringend nötig, um den Wohlstand zu bewahren, bei gleichzeitigem Klimaschutz: „Sodass weiterhin hier Industrie produzieren kann und die Leute Arbeit haben.“
Das Gesetz billigt auch den Transport von CO2 in Pipelines, die aber noch nicht existieren. Mit ihnen könnte das Klimagas beispielsweise nach Norwegen gepumpt und dort in alte Öl- und Gasfelder unter den Meeresgrund der Nordsee gepumpt werden. Norwegen hat hier bereits eine erste Speicheranlage in Betrieb. Und auch in Dänemark, so Christoph Hilgers, habe man ein altes Erdölfeld entwickelt, das in den nächsten ein bis zwei Jahren in Betrieb gehen werde. CCS werde dort „sehr stark gepusht“.
Salzwasserhaltige Gesteinsschichten als Riesenspeicher
Während alte Öl- und Gasfelder in Deutschlands Untergrund geschätzt etwa 2,8 Gigatonnen (Milliarden Tonnen) speichern können, schaffen saline Aquifere 20 bis 115 Gigatonnen (externer Link). Allerdings sind diese weniger gut erforscht. Befürchtet wird, dass durch das Pressen des Gases in den Boden salzhaltiges Wasser ins Grundwasser getrieben werden und dieses kontaminieren kann. Zudem könnte der Boden versauern, Bodenbakterien und Pflanzen könnten geschädigt werden, so das Umweltbundesamt (externer Link).
Mängel beim Monitoring und der Prüfung auf Umweltverträglichkeit
Christoph Hilgers verweist allerdings darauf, dass diese Gesteinsschichten mindestens einen Kilometer tief unter der Oberfläche liegen. Es gebe auch einen salinen Aquifer unter der Nordsee, der schon seit 1996 betrieben werde und als Speicher funktioniere. Franziska Holz vom DIW sieht jedoch noch weiteren Forschungsbedarf, um die Sicherheit zu garantieren und bemängelt, dass die Technologie für ein umfassendes Langzeitmonitoring noch fehlt. Zudem kritisiert sie, dass im bisherigen Entwurf des Kohlendioxidspeicherungsgesetzes die Umweltverträglichkeitsprüfungen reduziert wurden.
Dennoch betont Holz, dass mit dem neuen Gesetz jetzt zumindest versucht wird, Rahmenbedingungen zu schaffen, wie man im großen Maßstab industrielle Emissionen abscheiden kann. Und auch Christoph Hilgers begrüßt das Gesetz: „Ich denke, es muss was passieren, man muss Lösungen finden, wir können so größere Mengen von unvermeidbarem CO2 abfangen und speichern und eine andere Möglichkeit haben wir momentan nicht.“