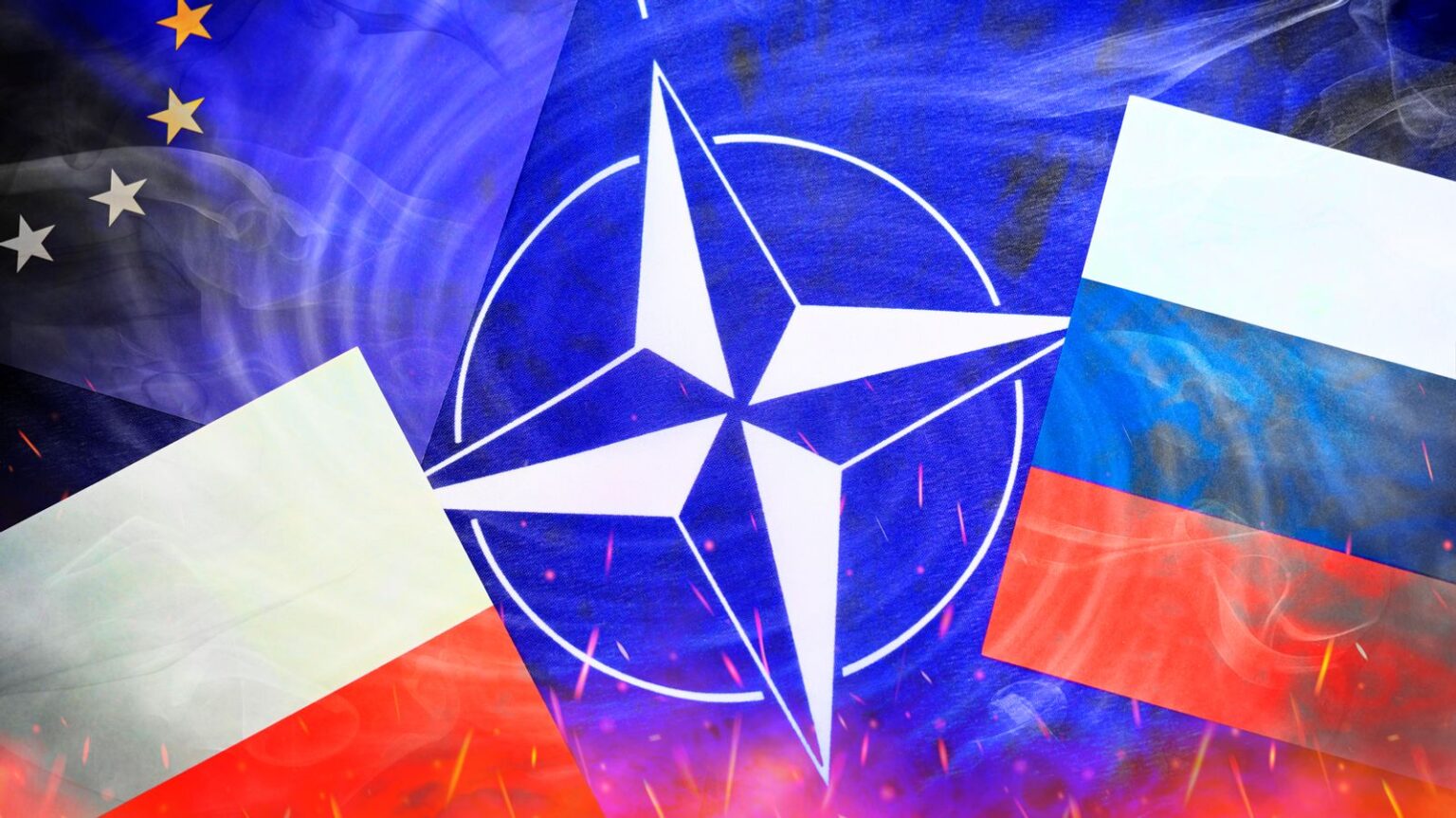Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich die Art der Kriegsführung verändert. Sowohl die russischen Aggressoren als auch die ukrainischen Verteidiger setzen mehr und mehr auf Drohnen. Dabei zählen bayerische Hersteller wie Quantum Systems, Helsing und Donaustahl nach eigenen Angaben zu den wichtigsten Lieferanten der Ukraine. Um künftig auch die knapp 3.000 Kilometer lange Ostgrenze der Nato gegen eine mögliche russische Aggression zu schützen, plädiert vor allem das Münchener Startup Helsing für einen sogenannten Drohnenwall.
Die Idee: Die Nato lagert hunderttausende von Drohnen ein, um sie im Notfall schnell einsetzen zu können. Ein Milliardengeschäft für die Hersteller. Die Software der Drohnen in den Depots könnte vor dem Ernstfall aktualisiert werden, argumentiert Helsing. Florian Seibel, Gründer und Chef des Konkurrenten Quantum Systems aus Gilching sieht das anders.
Heute aktuell, in ein paar Monaten nutzlos?
Soll die Abschreckung mittels eines Drohnenwalls funktionieren, dann müsse nicht nur die Software auf dem neuesten Stand sein, sagt Seibel. So gebe es auch bei der Hardware ständige Weiterentwicklungen. Die Auflösung der Kameras an Bord werde ständig besser, die Sensoren werden sensibler und die Rechenleistung der Drohnensysteme erhöhe sich. Deswegen bezweifelt Florian Seibel, dass es sinnvoll wäre, hunderttausende von Drohnen auf Vorrat zu bauen und für den Ernstfall einzulagern. Dann bestehe die Gefahr, dass die Systeme völlig veraltet und damit nutzlos wären, wenn sie gebraucht würden. Die Nato hätte in einem solchen Fall Milliardensummen verschwendet.
Reservefabriken für den Ernstfall?
Der Chef von Quantum Systems plädiert deshalb für eine andere Lösung. Er fordert im Interview mit dem BR, unter dem Schlagwort „Kaltstartfähigkeit“ die Kapazitäten der deutschen Industrie so zu koordinieren, dass ein Netzwerk von Unternehmen im Ernstfall schnell modernste Drohnen in großer Zahl produzieren könnte. Der Ex-Offizier argumentiert, dass sich ein großer militärischer Konflikt an der Ostgrenze der Nato über Monate ankündigen würde. Schließlich würde auch die russische Seite Zeit brauchen, einen groß angelegten Angriff vorzubereiten. Diese Zeit könnte die hiesige Industrie dann nutzen, ist Seibel überzeugt: „Was die deutsche Wirtschaft kann, das ist Stückzahl. Wenn die deutschen Autobauer pro Jahr problemlos Millionen Fahrzeuge im Jahr produzieren können, dann dürften im Ernstfall 20 Millionen Drohnen kein Problem sein.“
Dafür brauche es aber auch eine Entscheidung der Politik, Geld zum Beispiel in eine bayerische Drohnenfabrik zu investieren, die für den Fall der Fälle bereitgehalten wird. Auch in Bundeswehrkreisen wird nach Informationen des BR über eine solche industrielle Reserve diskutiert, eine Entscheidung gibt es aber noch nicht.
Milliarden für Gepard-Nachfolger
Eine andere Beschaffungsentscheidung ist dagegen bereits gefallen und soll in Kürze massiv erweitert werden. So erhält die Bundeswehr einen neuen Flugabwehrpanzer, der als Nachfolger des hierzulande ausgemusterten Gepard-Hubschrauber Tiefflieger und vor allem Drohnen bekämpfen soll. Rheinmetall hat mit dem sogenannten Skyranger einen Geschützturm mit einer Schnellfeuerkanone entwickelt, der sich auf verschiedene Panzersysteme montieren lässt.
Bisher hatte Berlin 18 solcher Fahrzeuge bestellt. Angesichts des massiven Einsatzes von Drohnen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine will das Verteidigungsministerium nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aber nochmals mehrere hundert Skyranger in Auftrag geben. Auch die Ukraine hat das Luftabwehrsystem in den vergangenen Tagen bei der Rüstungsmesse DSEI in London bestellt. Spätestens seit dem Eindringen vermutlich russischer Drohnen in den polnischen Luftraum wird auch der Regierung in Warschau ein dringendes Interesse am Skyranger nachgesagt. Ein Milliardengeschäft für Rheinmetall.
Moore und Sümpfe als Bollwerk
Länder wie Polen, die baltischen Staaten und Finnland wollen zum Schutz ihrer Grenzen und damit der Nato-Ostflanke nicht nur auf Waffen und Hightech setzen. Vor allem Polen und Finnland haben sich zuletzt auf eine Strategie zurückbesonnen, die seit Jahrtausenden von Militärs genutzt wird. Die Regierungen in Helsinki und Warschau wollen nämlich mit großem Aufwand trocken gelegte Gebiete renaturieren und Moore und Sümpfe als natürliche Panzersperren nutzen. Insgesamt geht es um bis zu 100.000 Hektar. Ein Sprecher des polnischen Verteidigungsministeriums bestätigte der Plattform „Politico“ entsprechende Pläne. Dies hätte auch aus Sicht des Klimaschutzes Vorteile: Moore gelten als exzellente CO₂-Speicher.